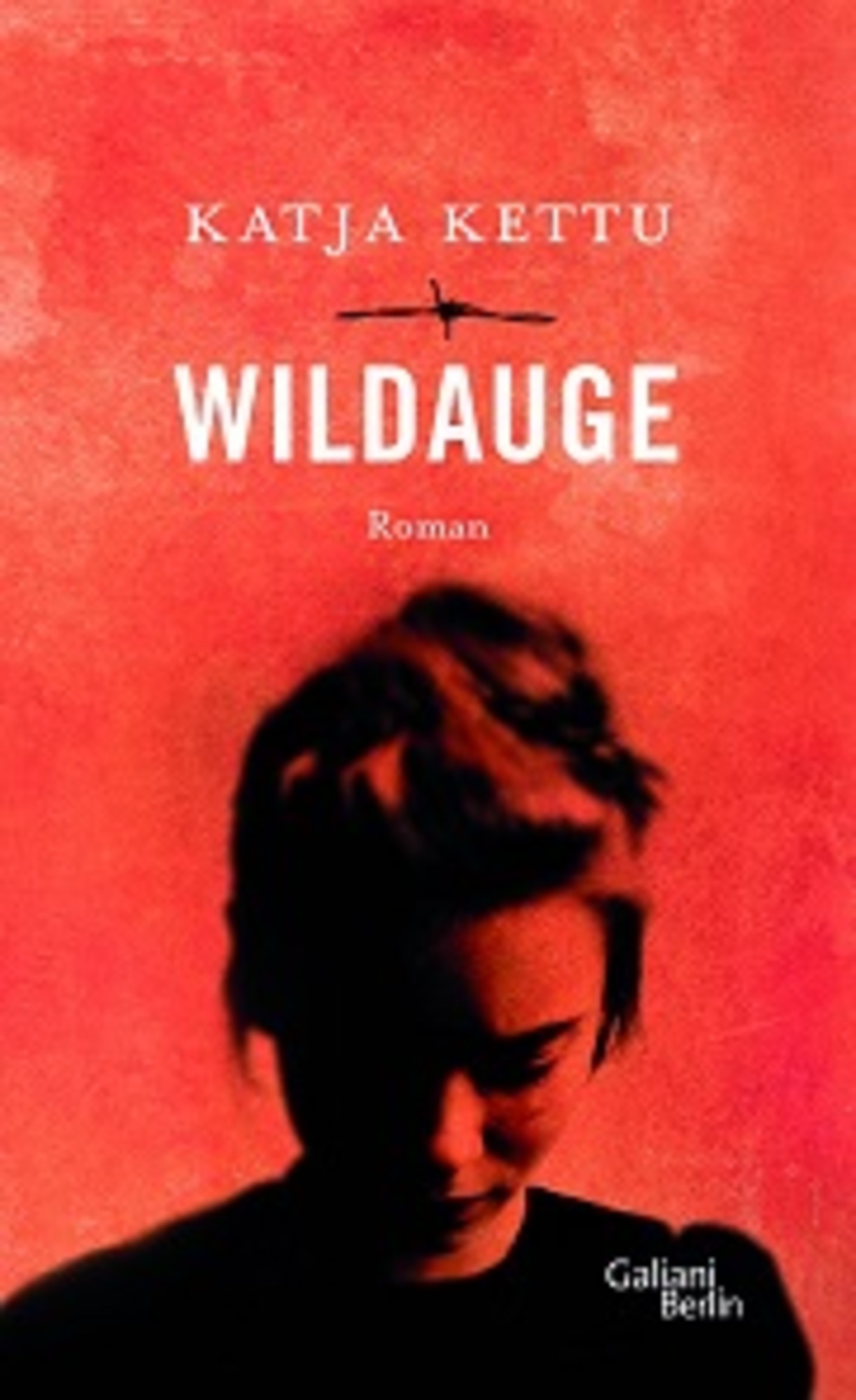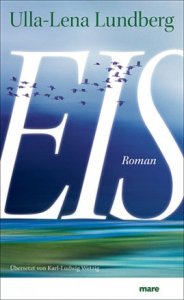„Wurfschatten“ ist der Erstlingsroman der Schweizerin Simone Lappert, in dem die Heldin Adamine, die verständlicherweise lieber Ada genannt werden will, mit ihren Ängsten kämpft. Dabei beobachtet sie die Wurfschatten der Passanten, die unter dem Fenster ihrer Wohnung vorbei ziehen.

Die Angst vor der Angst
Wovor die 25-jährige Ada wirklich Angst hat, findet der Leser nicht heraus. Zwar gibt es in ihrer Wohnung eine Angst-Tapete im von ihr so genannten Therapiezimmer, auf der alle Dinge von A wie Attentat bis Z wie Zyste abgebildet sind, und doch, die eigentlichen Angstauslöser sind nicht dabei. Vielmehr bekommt man als Leser den Eindruck, es ist Adas Angst vor der Angst, die sie lähmt. Vielleicht ist es aber auch nur eine bequeme Ausrede, die Ada benutzt, um von ihren eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken. Ada hat sich dafür nur leider die falsche Generalentschuldigung ausgesucht, in die sie sich hineinsteigert – diese macht sich nämlich selbstständig, und überfällt Ada immer dann, wenn sie es am wenigsten gebrauchen kann. Mit feiner Sprache zeichnet Simone Lappert Adas Angstanfälle, die selten echte Panikattacken sind, und sie doch am Leben hindern. Dabei gibt die Autorin den Situationen meist noch einen komischen Anstrich, der verhindert, dass ihre Hauptfigur mitleidheischend und überdreht wirkt.
Meistens kommt es anders
Frischer Wind kommt in Adas Leben, als ihr Vermieter, dem sie mehrere Monatsmieten schuldet, sie aus Mitgefühl nicht auf die Straße setzt, sondern stattdessen seinen Enkel Juri bei ihr einquartiert. Obwohl Ada dies nie zugeben würde, tut ihr der andere Mensch in der Wohnung gut. Sie stellt ihre Ängste zurück und konzentriert sich nun darauf, den Mitbewohner hinauszuekeln. Daraus entwickelt sich eine Freundschaft, und es droht sich sogar eine zaghafte Liebesgeschichte anzubahnen. Droht, weil Ada das um jeden Preis verhindern will, denn sie findet, Liebe ist nur dazu da, um in Schmerz zu enden und damit ein Grund, Angst zu haben. Dennoch, durch Juri kommt Ada zu einer veränderten Sicht der Welt, die Ängste werden immer häufiger zurückgedrängt und es zeigt sich ein Ausweg aus ihrer lähmenden Situation.
Mein Fazit
Ein bisschen Ada steckt irgendwo in jedem von uns. Jeder steckt einmal in einer vermeintlichen Sackgasse. Die Beschreibung der Angstanfälle lässt Spielraum für Phantasie und wirkt bisweilen komisch, ist allerdings nicht so gestaltet, dass sich Menschen mit Panikattacken ins Lächerliche gezogen fühlen. Beim Lesen fällt Mitgefühl mit Ada leicht und gleichzeitig möchte ich ihr gerne einen Schubs geben: Na los, Mädchen, ändere doch endlich etwas! Teilweise beschleicht mich der Eindruck, dass sich Ada sogar gefällt in ihrem Leben, dass sie gar nichts ändern will, und dass sie nur der Druck von außen dazu zwingt – noch etwas, das sie mit fast allen Menschen gemein hat.
Mit „Wurfschatten“ ist es Simone Lappert gelungen, ein tragikomisches Bild zu zeichnen, dessen Lektüre für all jene zu empfehlen ist, die sich selbst nicht immer ganz ernst nehmen und mit Humor auf jene Schwellen im Leben zurückblicken, an denen sie nicht mehr Kind, aber auch noch nicht erwachsen waren.
Simone Lappert, Wurfschatten
Metrolit Verlag, 2014
Online bestellen: https://www.buchhandel.de/buch/Wurfschatten-9783849300951
Autor: Harry Pfliegl